„Die bestehende augenärztliche Versorgungskapazität bestmöglich nutzen“ – Ein Interview mit Prof. Alexander Schuster
Er ist Inhaber der deutschlandweit ersten Professur zur ophthalmologischen Versorgungsforschung. EYEFOX hat mit Univ.-Prof. Dr. Alexander K. Schuster über die Entwicklung der augenärztlichen Versorgung in Deutschland und Strategien zu deren Verbesserung gesprochen.
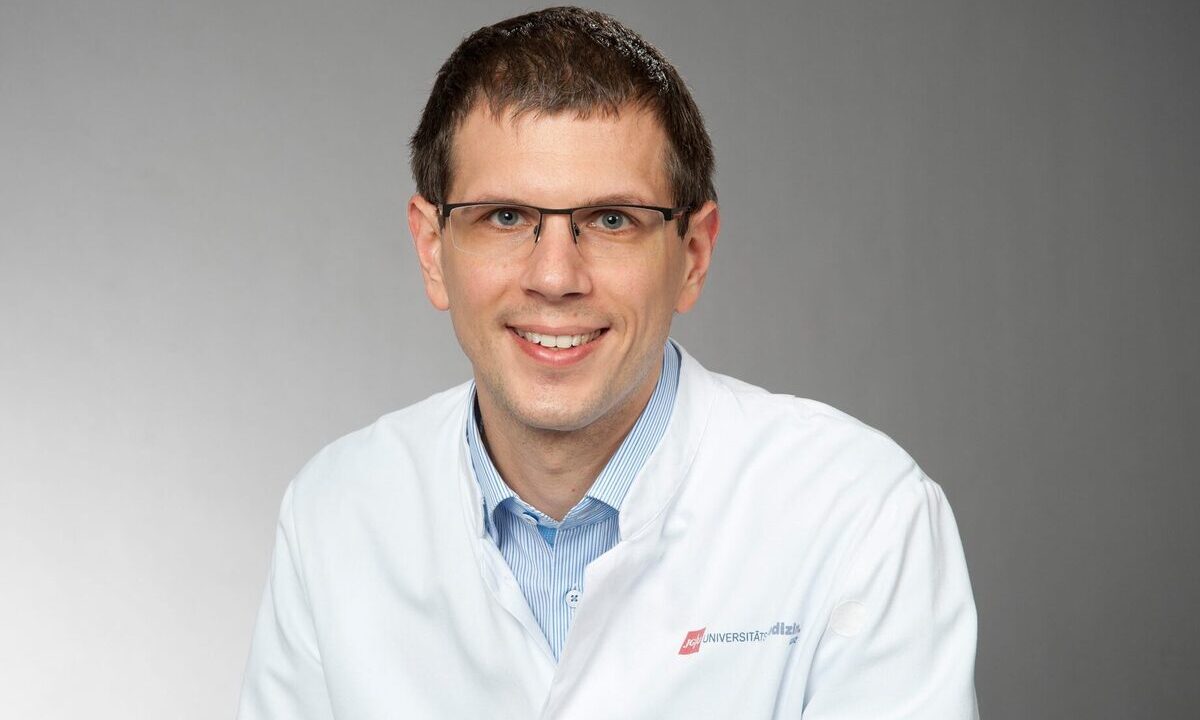
Herr Prof. Schuster, seit 2017 habe Sie die Professur zur ophthalmologischen Versorgungsforschung an der Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz inne. Warum wurde diese Professur ins Leben zu rufen?
Univ.-Prof. Dr. Alexander K. Schuster: Damals lagen relativ wenig Daten zur ophthalmologischen Versorgungssituation in Deutschland vor. Gleichzeitig fand ein Wandel in der Versorgung statt: Es gab neue Therapien, von denen unklar war, welche Ergebnisse sie in der Versorgung zeigten. An ersten Daten sah man, dass die Versorgung nicht dem entsprach, was die Studien versprachen – etwa, wenn man die Anti-VEGF-Therapie bei exsudativer AMD betrachtet.
Auch über die augenärztliche Versorgungskapazität lagen zu wenig Daten vor. Wir wissen, dass die Zahl der Augenärzte wächst, sich aber gleichzeitig in den letzten zehn Jahren ein Wandel in der Beschäftigungsform vollzogen hat – von vermehrt selbstständigen zu vermehrt angestellten Augenärzten. Wir leben zudem in einer alternden Gesellschaft: viele Augenerkrankungen treten primär im höheren Alter auf. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird es eine Herausforderung sein, diesen vermehrten Versorgungsbedarf adäquat zu decken.
|
Alexander K. Schuster ist Inhaber der deutschlandweit ersten Professur zur ophthalmologischen Versorgungsforschung. An der Universitätsaugenklinik Mainz leitet er das Zentrum für ophthalmologische Epidemiologie und Versorgungsforschung. |
Wo liegen aktuell die Schwerpunkte Ihrer Forschungen?
Einer der Schwerpunkte liegt auf der Epidemiologie, der Schaffung von Grundlagen. Wir erforschen, welche Augenerkrankungen wie häufig auftreten, in welchen Stadien sie erkannt und einer entsprechenden Therapie zugeführt werden. Idealerwiese werden Patienten rechtzeitig, das heißt meist frühzeitig, identifiziert und behandelt, um am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Des Weiteren schauen wir, wie Therapien im Alltag tatsächlich angewendet werden und welche Ergebnisse damit erzielt werden können, etwa bei Verfahren wie der klassischen IVOM-Therapie. Die IVOM-Therapie ist ein sehr erfolgreiches, aber leider auch sehr teures Verfahren, bei dem sich inzwischen auch auf Bevölkerungsebene zeigt, dass es Erblindung durch feuchte Makuladegeneration deutlich reduzieren kann. Natürlich spielt hier in Mainz auch das Thema Glaukomversorgung eine wichtige Rolle.
Grundlage von Versorgungsforschung ist qualifiziertes Datenmaterial. Wie gelangen Sie an diese Daten?
Zum einen läuft hier in Mainz die Gutenberg Gesundheitsstudie, eine große epidemiologische Kohortenstudie mit 15.000 Teilnehmern, die alle 5 Jahre nachuntersucht werden. Hier findet gerade das 15-jährige Follow-up statt, bei dem man sieht, welche Krankheiten in der Allgemeinbevölkerung auftreten und wann diese in der Regelversorgung erkannt werden. Zudem kooperieren wir, was die Epidemiologie angeht, mit anderen bevölkerungsbasierten Studien in Deutschland. Zur Erforschung der Versorgungssituationen finden Auswertungen in Zusammenarbeiten mit verschiedenen Krankenkassen statt. Deren Daten sind allerdings kritisch zu betrachten und auszuwerten, da hier natürlich nur das erscheint, was zuvor in der Regelversorgung dokumentiert wurde.
Steht Ihnen der Datenschutz bei Ihren Forschungen manchmal im Wege?
Eigentlich nicht. Doch es wäre hilfreich, wenn es einen deutschlandweiten Datensatz gäbe, der aus den ganzen GKV-Datensätzen gespeist wird und der zu Forschungszwecken frei genutzt werden könnte. Herr Spahn hatte ihn initiiert, aber er steht uns noch nicht zur Verfügung. Inwieweit der Datenschutz hierfür verantwortlich ist oder ob die verschiedenen Behörden die gesetzliche Vorgabe noch nicht umgesetzt haben, ist mir nicht klar.
Dieser Datensatz würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Stattdessen ist man auf eine Kooperation mit den einzelnen Krankenkassen angewiesen und es können keine übergreifenden Analysen für ganz Deutschland erstellt werden, wie es in anderen Staaten bereits möglich ist.
Welche Bedeutung hat das nationale Ophthalmologische Register „oregis“ für ihre Arbeit?
Ich war bei der Planung und Initiierung des oregis-Registers mit involviert und berate das oregis-Team regelmäßig bei der Analyse von Daten. Es ist derzeit wichtig, möglichst viele Kliniken und Praxen für eine Mitarbeit zu gewinnen, um nachher annähernd repräsentative Daten auswerten zu können. Die Hoffnung ist, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen möglichst großen Teil der Augenärzteschaft hiervon überzeugen können – auch durch die Einführung von elektronischen Patientenakten sowohl in den Kliniken als auch in der Niederlassung. Dann wird oregis ein sehr spannendes Tool sein, mit dem man Fragen der Versorgungsforschung beantworten kann, denn das Register erhebt deutlich detailliertere Daten als die Krankenkassen. Es stellen bereits einige Kliniken und auch niedergelassene Kollegen ihre Daten zur Verfügung – dies ist ein guter Anfang, aber es sollte möglichst noch stärker in die Breite gehen.
In einem persönlichen Gespräch erklärte mir der Inhaber einer großen Augenarztpraxis vor kurzem, der Markt für Augenärzte sei leergefegt. Gibt es in Deutschland zu wenig Augenärzte?
Wir sind weltweit das Land mit der höchsten Augenarztdichte, sodass wir nicht sagen können, in Deutschland gäbe es zu wenig Augenärzte. Aber es ist sicherlich der Fall, dass die Nachfrage nach Augenärzten höher als das Angebot ist. Das heißt, dass Kollegen mitunter Schwierigkeiten haben, Praxen nachzubesetzen – insbesondere, wenn vermehrt Augenärzte in Anstellung gesucht werden. Es ist zudem schwieriger Augenärzte zu finden, die bereit sind, in ländliche Regionen zu gehen. Ähnliches, so höre ich es von verschiedenen Kollegen, gilt jedoch auch für manche städtische Regionen. Die Politik muss überlegen, wie unser Versorgunggeschehen so zu steuern ist, dass die Patienten, die dringend eine Versorgung benötigen, diese auch bekommen. Ein erster Ansatz waren die freien Sprechstundenzeiten für Notfallpatienten, sodass für dringende Behandlungen Kapazität zur Verfügung gestellt wurde. Ob man dies gesetzlich verankern sollte oder ob es jede Praxis individuell einplanen sollte, dass für akut Erkrankte ausreichend Kapazitäten wohnortnah vorhanden sind, das ist eine politische Entscheidung.
Wie wird sich die augenärztliche Versorgung in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln – in einer alternden Gesellschaft, in der dementsprechend die altersbedingten Augenkrankheiten rapide zunehmen und in der gleichzeitig die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen?
Bis 2050 wird es zu einem weiteren Anstieg an erkrankten Personen in der Allgemeinbevölkerung kommen und gleichzeitig wird die Versorgungskapazität wahrscheinlich nur geringfügig zunehmen. Die Zahl der Augenärzte ist zwar in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen, doch die Verlagerung von selbstständiger zur angestellten Tätigkeit geht in aller Regel mit einer reduzierten Stundenzahl einher, sodass die Versorgungskapazität nur geringfügig gewachsen ist. Es ist ja nicht so, dass nur Augenärzte Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden. Dies gilt für alle Fachbereiche.
Deshalb müssen wir überlegen, wie wir die bestehende augenärztliche Versorgungskapazität bestmöglich nutzen können. Auf wissenschaftlicher Basis ist zu überlegen welche Kapazitäten für dringend Erkrankten bereitgestellt werden sollten und welche Augenerkrankungen Kontrollen in welchen Abständen bedürfen.
Hilfreich wären hier klare Empfehlungen, wer wie oft welche Kontrolluntersuchungen erhalten sollte. Beim diabetischen Retinopathie-Screening gibt es bereits solche klaren Vorgaben, dies sollte meines Erachtens auch für die anderen häufigen Augenerkrankungen entwickelt werden. Letztlich ist es das Ziel, die bestmögliche augenärztliche Versorgung der Gesellschaft aus unserer vorhandenen Versorgungskapazität erzielen zu können, denn eine weitere Steigerung halte ich für nicht realistisch, wohingegen die Zahl an Patienten mit Augenerkrankungen weiter wachsen wird.
Kann KI dabei helfen, die Versorgung zu verbessern bzw. die Augenärzte zu entlasten?
Es gibt erste Ansätze, die zeigen, dass KI-basierte Algorithmen auch unter Alltagsbedingungen funktionieren können, beispielsweise beim Screening auf eine diabetische Retinopathie oder auf ein Glaukom, wenn die Bildqualität ausreichend gut ist. Die Frage ist jedoch, wie wir dies in Deutschland in die Regelversorgung integrieren können. Bisher besteht jedoch noch keine Möglichkeit, in der GKV-Abrechnung einfache Fundusaufnahmen abzubilden, auf denen in aller Regel die derzeit gängigen KI-Algorithmen basieren. Die OCT-Bildgebung ist inzwischen bei Erkrankungen der Makula, die funduskopisch den Verdacht einer Exsudation zeigen, im Einheitlichen Bewertungsmaßstab enthalten. Hier bringt KI meiner Meinung nach bislang keinen großen Zusatznutzen, aber dies könnte sich in den nächsten Jahren ändern, wenn Studien aufzeigen sollten, dass eine IVOM-Therapie mit einem spezifischen Medikament bei einem gewissen morphologischen Befund einen Vorteil hätte. Ein Algorithmus basierend auf KI ist aus meiner Sicht letztlich ein Tool, das einen Befund vorschlägt, der von einem Augenarzt zu validieren ist und diesen nicht ersetzt, sondern entlastet.
Welche Strategien zur Verbesserung der Versorgung würden Sie vorschlagen?
Das Wichtigste wäre meines Erachtens den Ärzten Entscheidungshilfen für die häufigsten Augenerkrankungen an die Hand zu geben – welche Erkrankung in welchem Schema therapiert werden sollte und falls keine Therapie möglich oder noch nicht angezeigt ist, in welchen Intervallen der Befund kontrolliert werden sollte. Meine Hoffnung ist, dass man die freiwerdenden Kapazitäten dann für die dringenden, akuten Erkrankungen nutzen kann, um so den Anstieg der Augenerkrankungen durch die Alterung der Bevölkerung etwas abzufedern. Es gibt erste Empfehlungen, was das diabetische Retinopathie-Screening angeht. Ähnliches bräuchten wir auch für Glaukom oder AMD – nicht zu kompliziert formuliert, sondern möglichst für den Alltag anwendbar. Bisher gibt es bereits Leitlinien, diese sind jedoch oft sehr umfangreich – wenn man etwa an englischsprachige Texte von mehreren Hundert Seiten denkt. Für den Alltag sind diese sicherlich nicht besonders hilfreich.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auf der Versorgungspraxis in der Diagnostik und Therapie bei Glaukomerkrankungen. Welche Erkenntnisse haben Sie bei diesen Forschungen gewonnen?
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass etwa nur die Hälfte der Glaukomerkrankten von ihrer Erkrankung wissen. Es gibt einerseits eine relativ hohe Dunkelziffer bei denen, die nicht zum Augenarzt gehen, aber eben auch bei Patienten, die eine Glaukom-Früherkennung ablehnen, weil es bislang keine Kassenleistung ist. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten ändern. Kürzlich wurden erste Daten aus Skandinavien publiziert, die zeigen, dass durch ein einmaliges, bevölkerungsbasiertes Screening die Zahl der Erblindungen durch Glaukom nach 20 Jahren tatsächlich halbiert werden kann. Ich habe die Hoffnung, dass diese Daten zu einem Umdenken insbesondere in der Politik führen: Denn bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie kann man eine Progression und eine Erblindung im hohen Alter in den allermeisten Fällen verhindern.
Inwieweit reagiert die Politik auf Ihre Forschungsergebnisse?
Wir machen Wissenschaft, keine Politik. Wir geben den Fachgesellschaften Daten an die Hand, die diese dann in die Politik tragen können, sodass Veränderungen stattfinden. Als Wissenschaftler versuche ich Erkenntnisse zu gewinnen und damit auch Grundlagen für politische Entscheidungen zu liefern. Sicherlich muss man hin und wieder die Politiker darauf hinweisen, dass es neue Erkenntnisse gibt, um dann im politischen Diskurs die Rahmenbedingungen für unsere Gesundheitsversorgung zu gestalten.
Interview: Achim Drucks